- Kurztext
- Autor/in
- Einblick
- In den Medien
- Downloads
Ohne dass sie sich ein kriminelles Delikt hatten zuschulden kommen lassen, wurden in der Schweiz bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein «liederliche» und «arbeitsscheue» Personen in Arbeitsanstalten eingewiesen. Am Beispiel des Kantons Bern zeigt das Buch, wie das fürsorgepolitische Zwangsinstrument der administrativen Anstaltsversorgung im 19. Jahrhundert eingeführt wurde, um Missbräuche im Armenwesen zu bekämpfen. Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Wachstums und der Einführung wichtiger Sozialversicherungswerke in den 1950er und 1960er-Jahren kam dieses Instrument weiterhin zum Einsatz. Kommunale und kantonale Behörden verwendeten es als gesellschaftliches Normalisierungs- und Disziplinierungsinstrument, um gegen Menschen vorzugehen, die gegen die herrschende bürgerliche Gesellschafts- und Geschlechterordnung verstiessen.
Das Buch arbeitet die Rechtsstaatsproblematik dieser Form der Anstaltsversorgung heraus und rekonstruiert, wie erst unter dem Druck eines nach dem Zweiten Weltkrieg erstarkenden internationalen Menschenrechtsdiskurses und zunehmender Kritik fürsorgerischer, politischer und öffentlicher Kreise die administrative Versorgung in allen Kantonen der Schweiz 1981 schliesslich aufgehoben wurde. Detaillierte Fallgeschichten verdeutlichen, was eine administrative Versorgung für eine betroffene Person bedeutete und mit welch umfassenden Interventionsbefugnissen die Behörden ausgestattet waren – und es ihnen dennoch nicht gelang, die Betroffenen im von ihnen gewünschten Sinn zu «resozialisieren».
1 Einleitung
2 Die Einführung der administrativen Versorgung im Kanton Bern
2.1 Kampf gegen «Liederlichkeit» und «Arbeitsscheu»
2.2 Das Grundrecht der persönlichen Freiheit – ein «schöner Dekorationstitel einer Verfassung»?
2.3 Das «Gesetz betreffend Errichtung kantonaler Arbeitsanstalten» (1884)
2.4 Unterbringung in verschiedenen Vollzugseinrichtungen
2.5 Die Entwicklung der administrativen Versorgungen nach 1884
2.5.1 Mägde, Taglöhnerinnen, Handlanger, Landarbeiter
2.5.2 Tendenz steigend: Die Zahl der Versorgungen in den ersten Jahrzehnten
2.5.3 Administrativ versorgte Männer in der Überzahl
2.6 Fazit
3 Ausweitung der staatlichen Interventionsmöglichkeiten 3.1 Das «Gesetz über die Armenpolizei und die Enthaltungs- und Arbeitsanstalten» (1912/13) 105
3.1.1 Eine Anstalt für «bösartige» Pfleglinge: Das Versorgungsheim Sonvilier
3.1.2 Die Verankerung weiterer gesetzlicher Gründe für eine administrative Versorgung
3.1.3 Das Versorgungsverfahren
3.1.4 Differenzierung des Vollzugs mit der Einführung der bedingten Versorgung
3.2 Zur Versorgungspraxis
3.2.1 Zu den Versorgungsgründen
3.2.2 Höchstwerte der Versorgungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
3.3 Fazit
4 «Die Anschuldigungen sind teilweise richtig, teilweise sind sie aber übertrieben»: Fallgeschichte Jakob Hofmann 4.1 «Menschenunwürdigen Verhältnissen» ein Ende bereiten: Versorgung 1939 in die Strafanstalt Witzwil
4.1.1 Die Vorwürfe der «Arbeitsscheu», «Liederlichkeit» und «Trunksucht»
4.1.2 Mit einer Versorgung «unter keinen Umständen einverstanden»
4.1.3 Psychiatrische Abklärung der «Versorgungsbedürftigkeit»
4.2 «Trinkerfrauenbarmherzigkeit»: Die Rolle der Ehefrau
4.3 Als «Rückf.lliger» zwei Jahre in der Straf- und Arbeitsanstalt St. Johannsen (1944–1946)
4.4 Zwei sistierte Einweisungsverfahren und ein schriftliches Freilassungsversprechen
4.5 Hofmann wird zu einem «Pflegefall»: Anstaltsunterbringungen in den 1950er-Jahren 176
4.5.1 Anstaltseinweisung gemäss Artikel 406 ZGB (1907/12)
4.5.2 Verschärfung der Massnahme und Versorgung 1955 auf «unbestimmte Zeit» in das Versorgungsheim Sonvilier
4.6 Fazit
5 «Bin ich also keine Verbrecherin, keine Diebin, keine Trinkerin»: Fallgeschichte Frieda Berger 5.1 Eine «unverbesserliche Dirne»: Intensivierung der behördlichen Zugriffe in den 1930er-Jahren
5.1.1 Entmündigung und zwei administrative Versorgungen
5.1.2 Verletztes Rechtsempfinden
5.2 Achteinhalb Jahre im Versorgungsheim Sonvilier – ein langer Kampf bis zur Entlassung
5.2.1 Ein Liebesbrief und eine gescheiterte probeweise Entlassung
5.2.2 «Bitte nochmals mich frei zu machen sofort»
5.3 Nach der Entlassung: Kampf gegen ein Stigma und ein kritischer Amtsvormund
5.3.1 «Mein Leben wurde mir verdorben durch die ungerechte Einsperrung»
5.3.2 «Solange über ihr Verhalten keine Reklamationen eintreffen, werde ich sie einfach machen lassen müssen»
5.4 «Wieder einen Galgentrik verübt»: Einweisungen nach Bärau und Sonvilier (1959–1963)
5.5 Fazit
6 Reformpostulate 6.1 «Es darf wirklich auch ein verstärkter Schutz der Persönlichkeit verlangt werden»
6.1.1 Die Kritik Carl Albert Looslis Ende der 1930er-Jahre
6.1.2 Kritik aus rechtswissenschaftlicher Sicht
6.2 Späte Kritik von Seiten fürsorgerischer Fachkreise
7 Zeit des Umbruchs 7.1 «Im Volk redet man sehr oft von Versenkung»: Die Aufnahme von Revisionsarbeiten am bernischen Versorgungsrecht
7.2 Das «Gesetz über Erziehungs- und Versorgungsmassnahmen» (1965/66)
7.2.1 Zwingende Anwendung von «Erziehungsmassnahmen ohne Anstaltseinweisung»
7.2.2 «Liederlichkeit» und «Arbeitsscheu»: Weiterhin gesetzliche Versorgungsgründe
7.2.3 Das Versorgungsverfahren: Ausbau des Rechtsschutzes
7.3 Forderung nach Berücksichtigung neuer Erkenntnisse der Fürsorge und der Sozialarbeit
7.4 Fazit
8 «Disteln im Bouquet unserer Freiheitsrechte»: Die Aufhebung der administrativen Versorgung 8.1 Unvereinbarkeiten des schweizerischen Rechts mit der EMRK
8.2 Die Menschenrechtsdebatte der eidgenössischen Räte 1969
9 Schluss
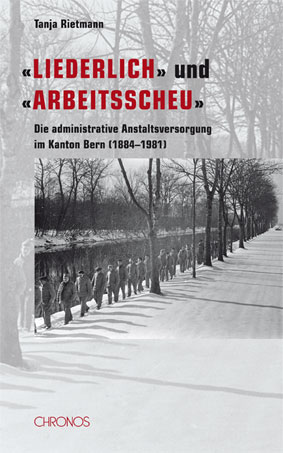
«Die Arbeit von Tanja Rietmann ist eine äusserst verdienstvolle Rekonstruktion erst jüngst im Namen des Sozialstaats Schweiz tausendfach verübten Unrechts. Sie ist von weit mehr als bloss historischem Interesse, wäre doch die Annahme vermessen, dass die befassten Professionen – Jurisprudenz, Medizin, Soziale Arbeit – mit der löblichen bundesrätlichen Entschuldigung nun für alle Zeit davor gefeit wären, sich in den Dienst unrechtmässiger Herrschaft zu stellen.»
Johannes Schleicher, Impuls. Magazin des Fachbereichs Soziale Arbeit
«Rietmanns Studie liefert eine präzise und kluge sozial-, rechts- und kulturgeschichtliche Analyse der administrativen Versorgungen, die auf kantonalem Recht beruhten. Sprachlich souverän und konzeptionell durchdacht, rekonstruiert und interpretiert sie die Fallgeschichten und zeichnet die rechtliche Entwicklung der administrativen Versorgung auf. […] Ihre Studie liefert gerade auch aktuellen politischen Debatten über die administrativen Versorgungen den nötigen wissenschaftlichen Background und schliesst eine wichtige Forschungslücke.»
Sabine Lippuner, Traverse
«Ein wertvoller Beitrag zur politisch höchst aktuellen, bisher jedoch gerade im Hinblick auf die administrative Anstaltsversorgung von Erwachsenen, erst punktuell erforschten Geschichte fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in der Schweiz. Sie verschafft fundierte Einblicke in die juristische und politische Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der kantonalen Gesetzgebung zur administrativen Anstaltsversorgung sowie neues Grundlagenwissen zur konkreten Ausgestaltung dieser Fürsorgepraktik im Kanton Bern.»
Gianna Virginia Weber, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte